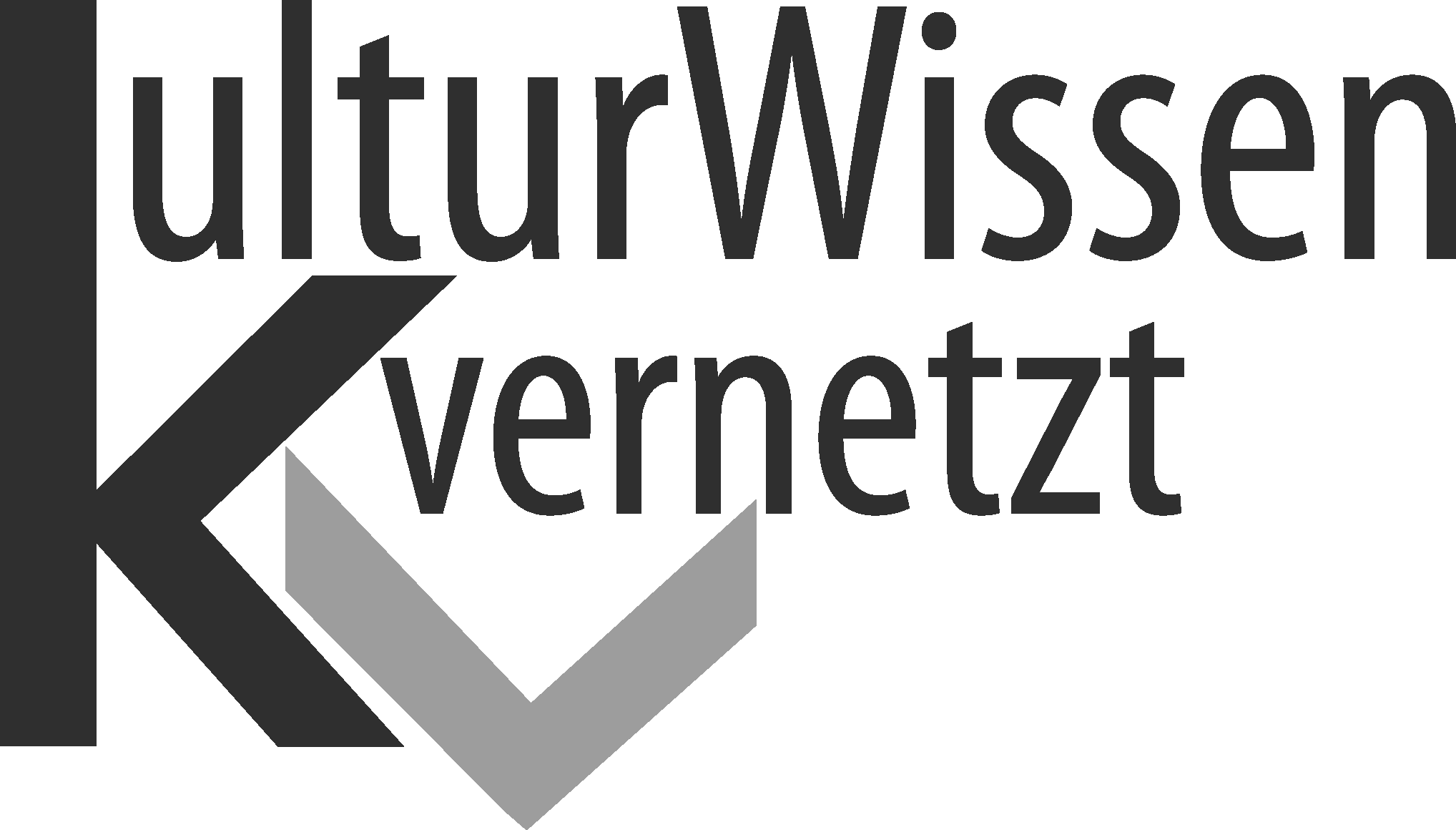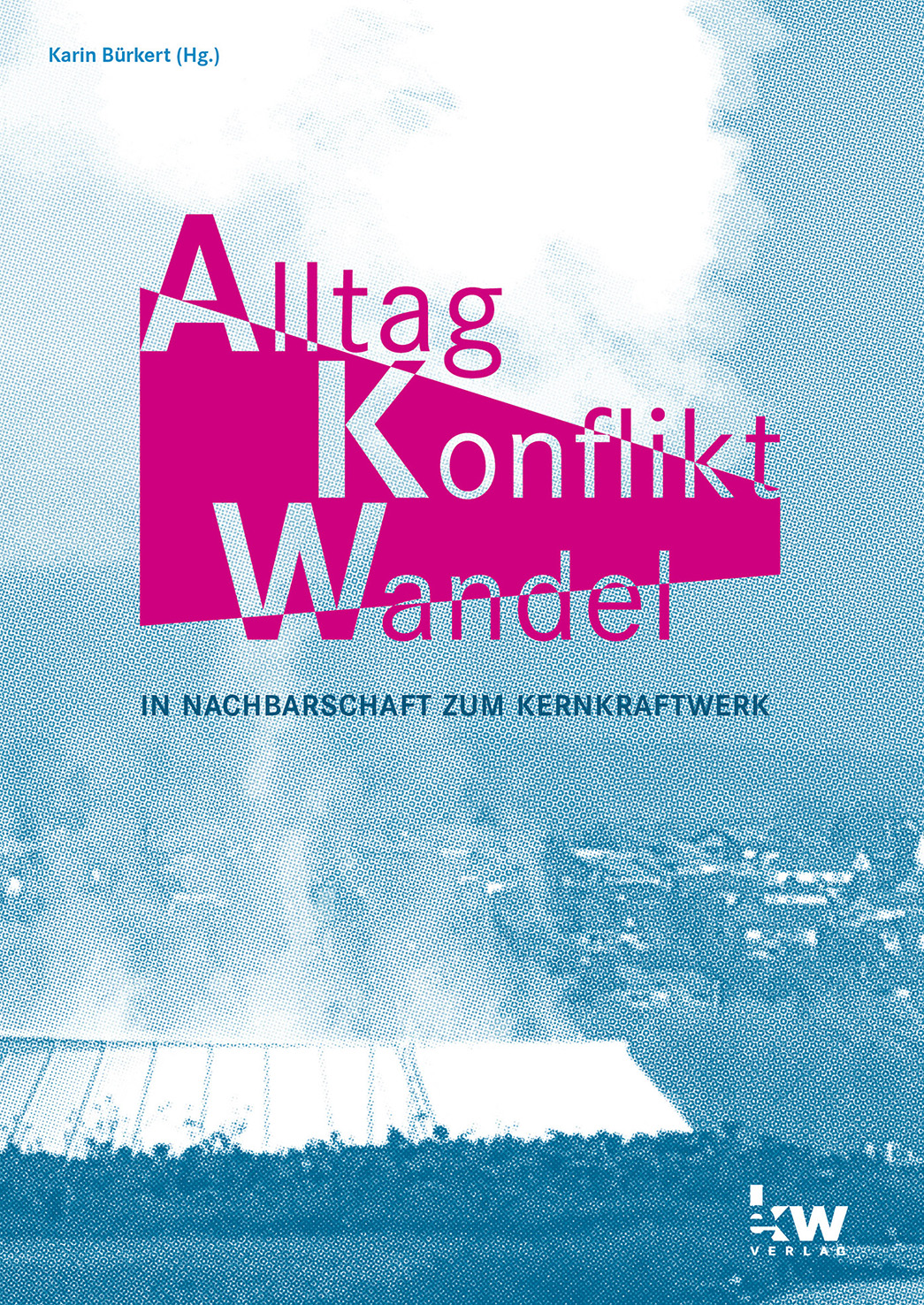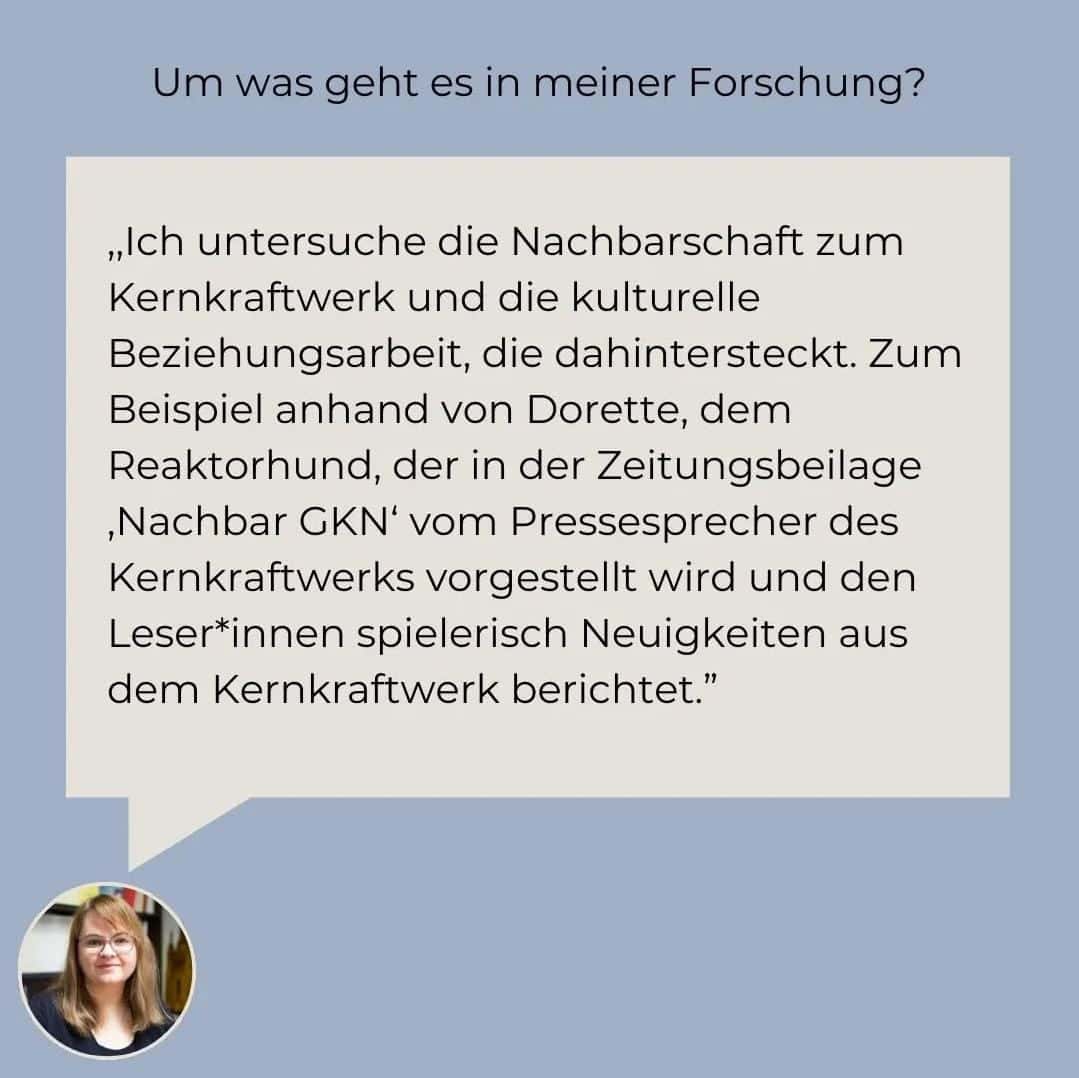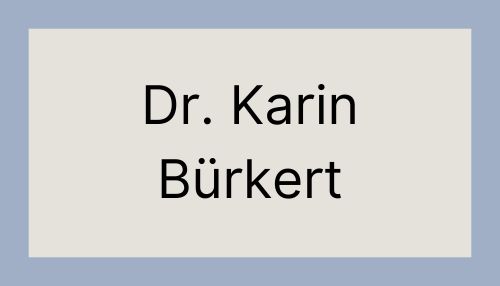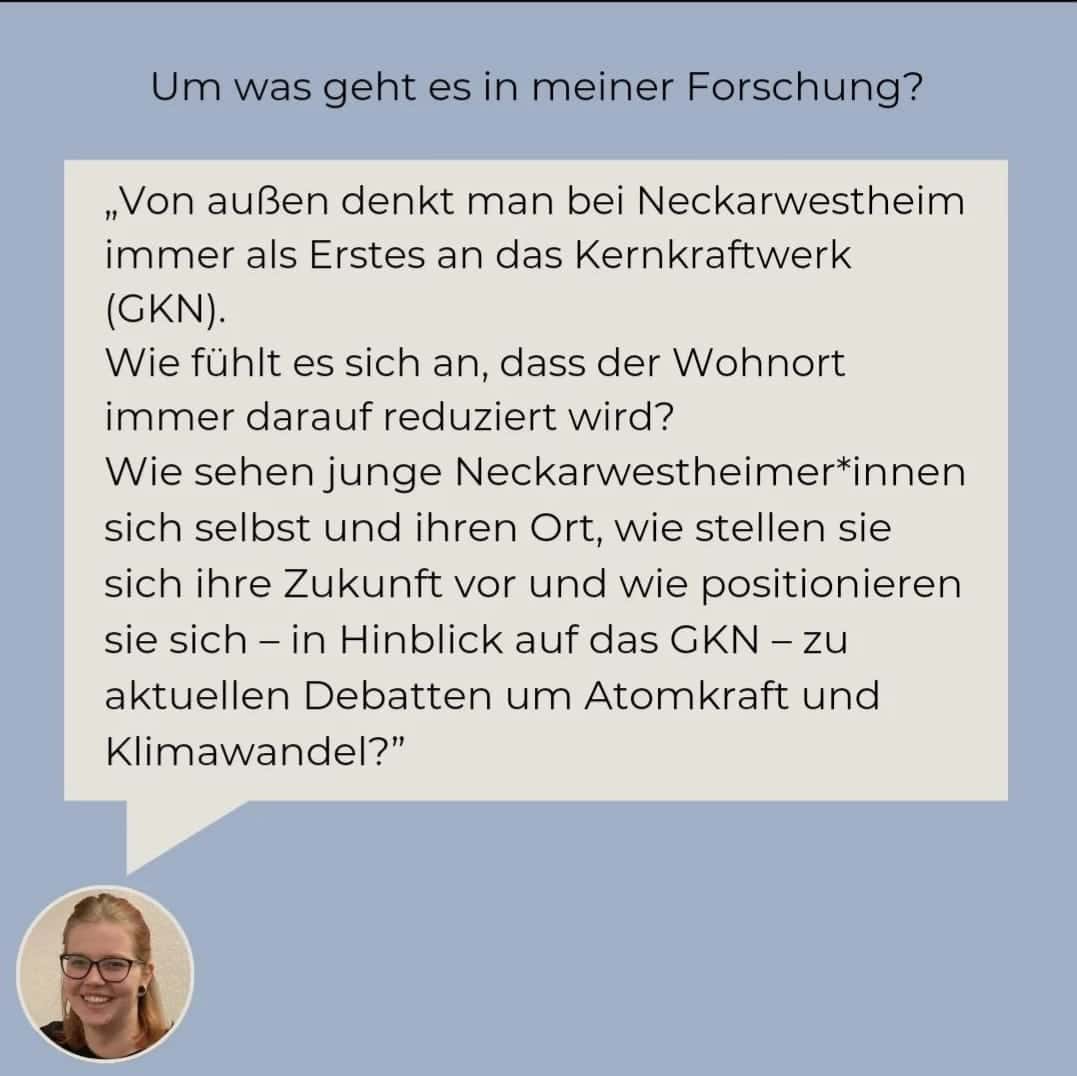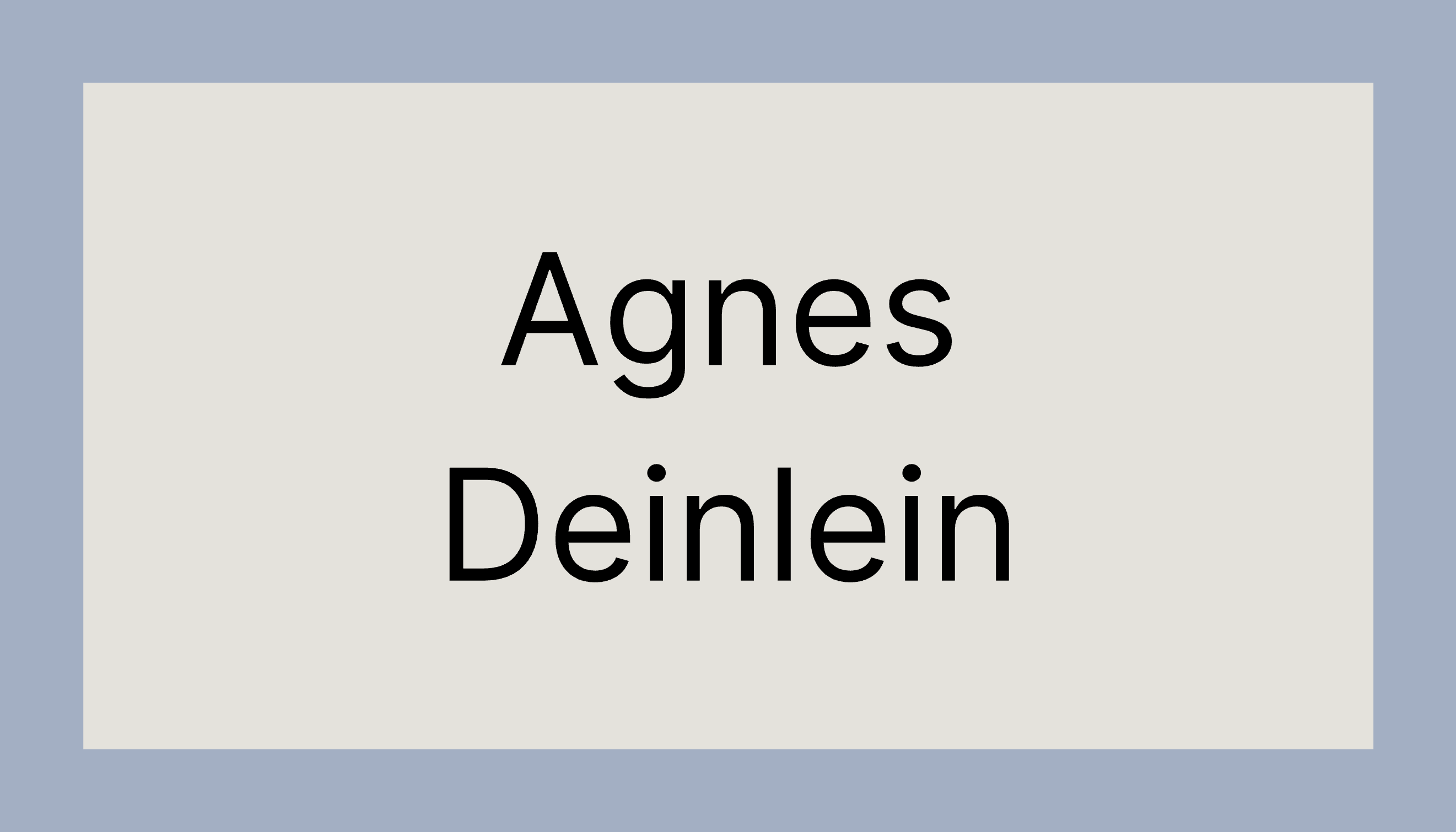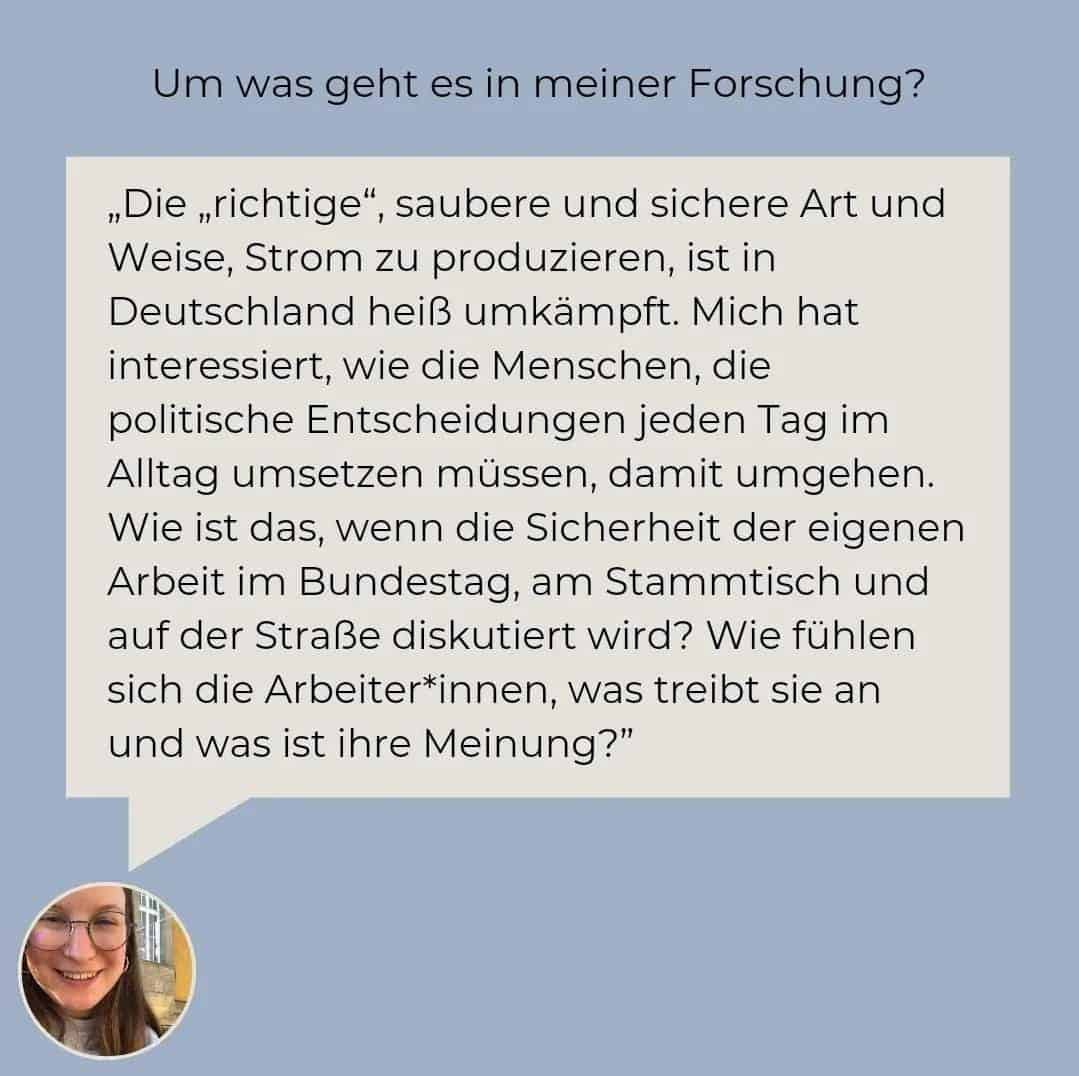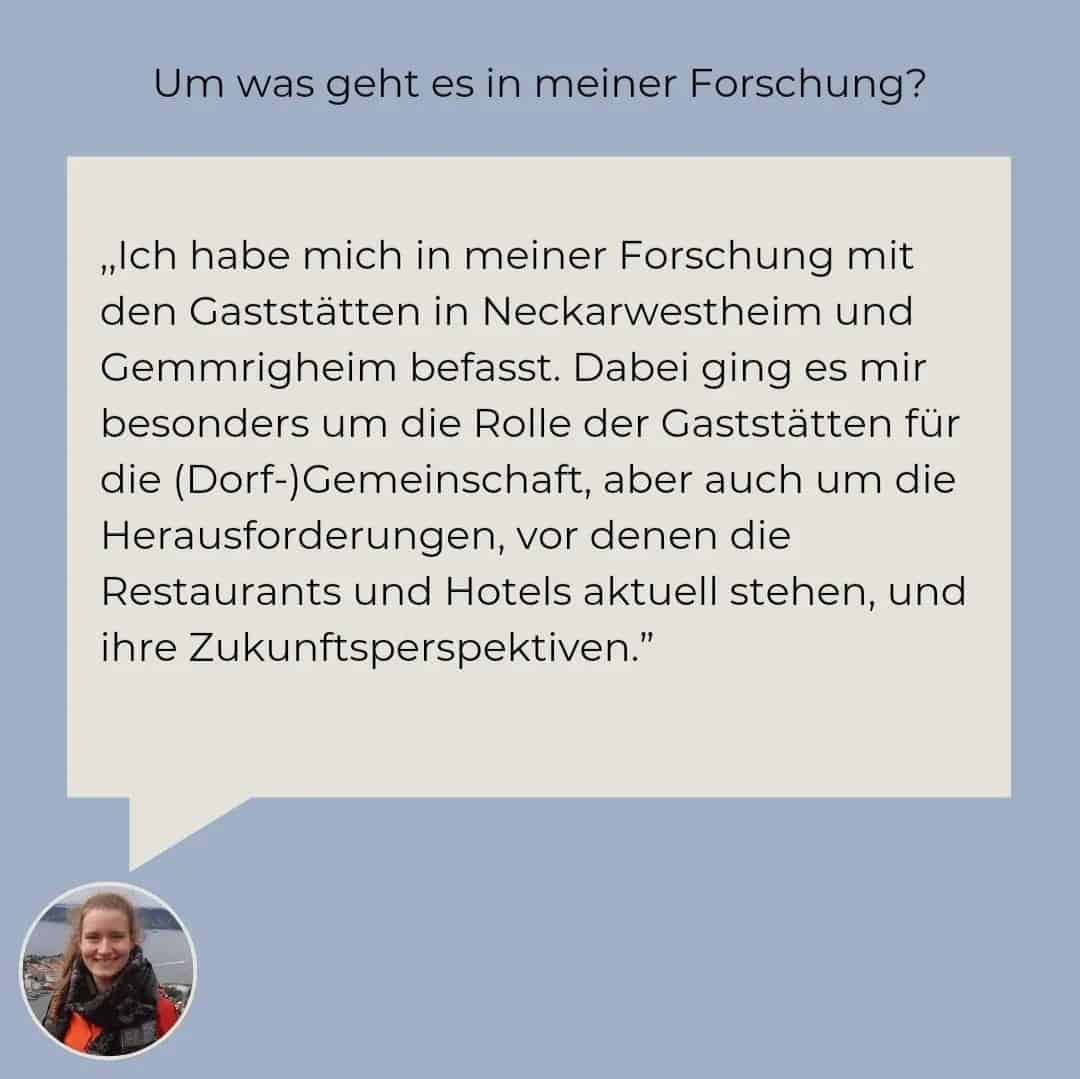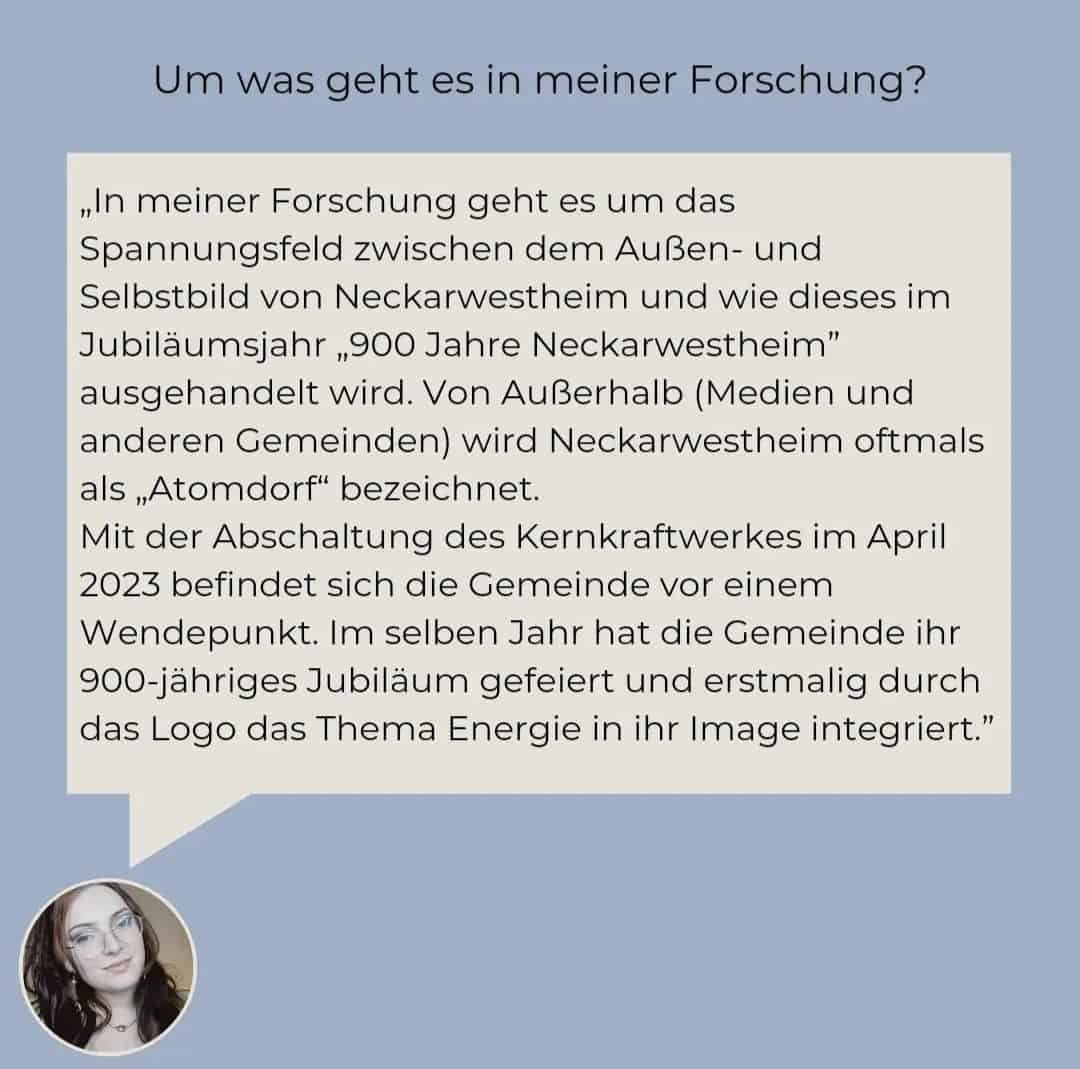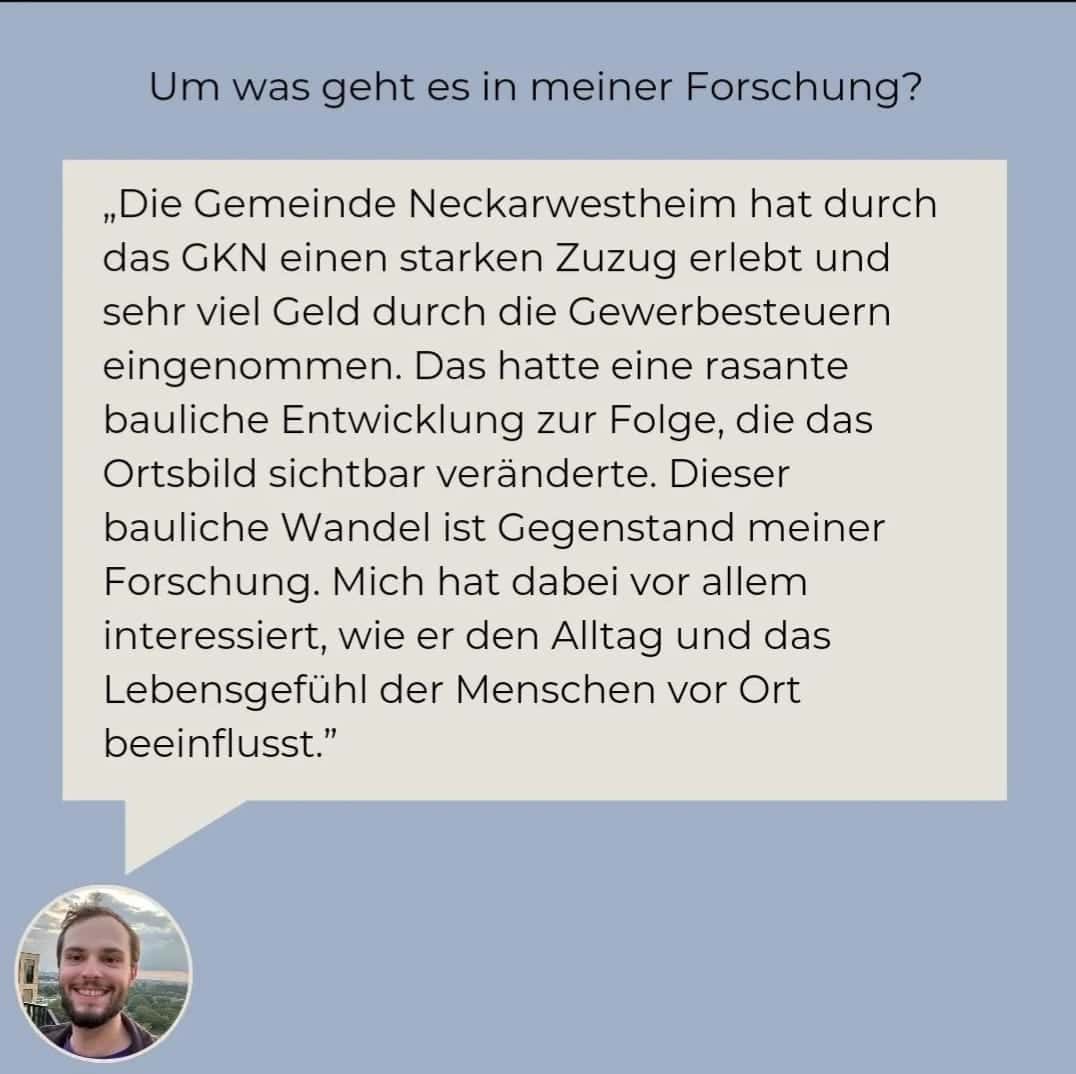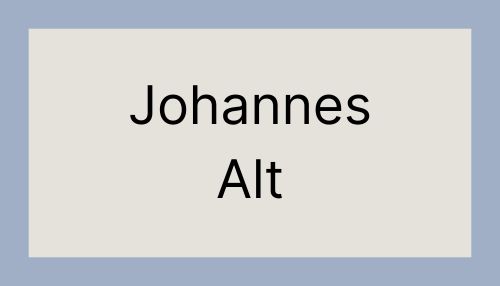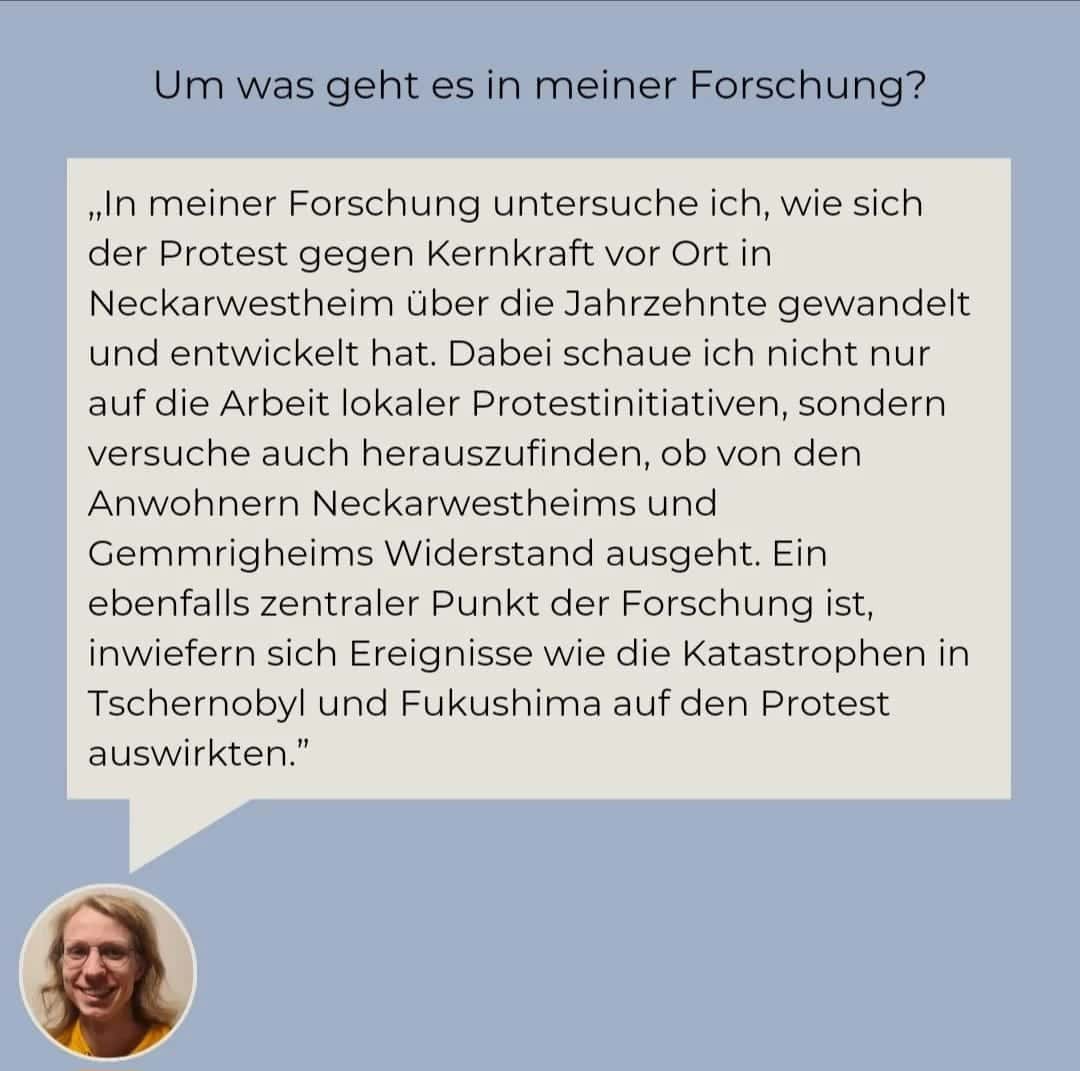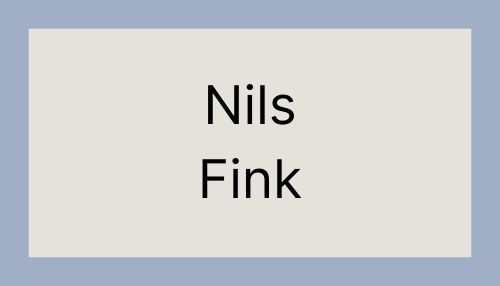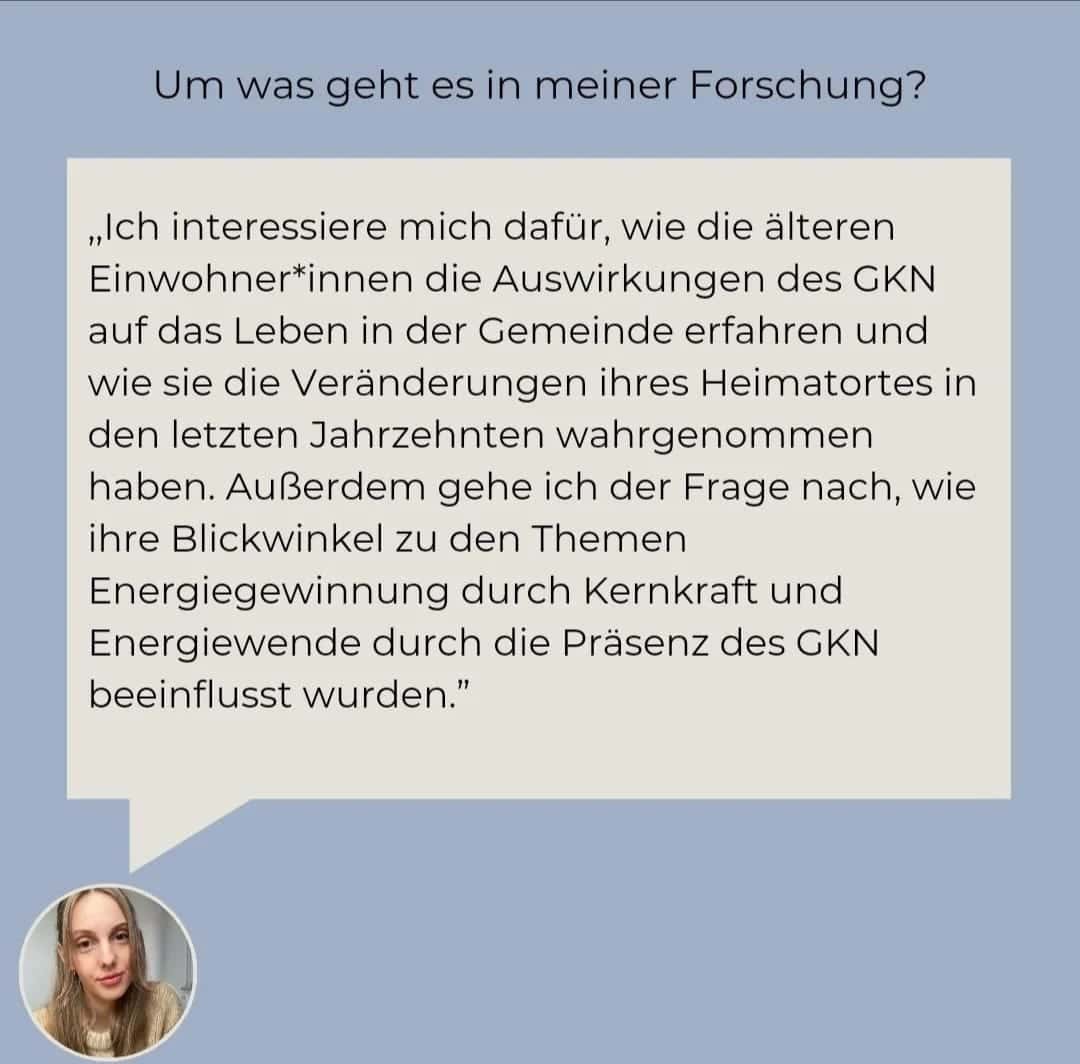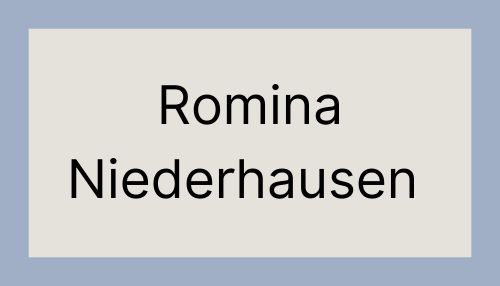„Grüß Gott, Nachbarn“ steht in der im März 1978 erschienen ersten Ausgabe der Zeitungsbeilage „Nachbar GKN“. Wie es sich unter Nachbarn gehört, stellte sich das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar (GKN) den Bewohner:innen der Gemeinden Neckarwestheim und Gemmrigheim vor. Fast 50 Jahre war das Kernkraftwerk fester Bestandteil der Region und die beiden Gemeinden profitierten von den hohen Gewerbesteuereinnahmen. Mit der Abschaltung von Block II im April 2023 endete eine Ära – geprägt von Nachbarschaft und Konflikten. Doch wie lebte und lebt es sich neben einem Kernkraftwerk als Nachbarn? Wie blicken die Menschen auf die bevorstehenden Veränderungen nach dem Atomausstieg und dem Rückbau des Kraftwerks? Wie spiegelten sich die kontroverse Debatte um das Für und Wider der Atomkraft in den Gemeinden vor Ort? Wie schrieb sich diese Verhandlung in das kollektive Gedächtnis und den Alltag der untersuchten Gemeinden ein? Und was bedeutet die Abschaltung für diejenigen, die dort arbeiten?
Diese Fragen untersuchten sieben Masterstudierende unter der Leitung von Dr. Karin Bürkert in einem dreisemestrigen Lehrforschungsprojekt der Empirischen Kulturwissenschaft Tübingen. Die Ergebnisse sind in dem Buch „Alltag. Konflikt. Wandel. In Nachbarschaft zum Kernkraftwerk“ dokumentiert, das am 18. April 2024 erstmalig in Neckarwestheim vorgestellt wurde. Die Studie zeigt, dass zwischen Kernkraftwerk und Gemeinden eine Art Nachbarschaft entstanden ist – mit Vertrauen, Verantwortung, aber auch Kontrolle und Verpflichtungen.

Forschungskontext „KulturWissen vernetzt“
Das Lehrforschungsprojekt war Teil des Strukturverbunds „KulturWissen vernetzt“ (2021–2026), gefördert von der VolkswagenStiftung. Der Fokus lag auf Transformationen ländlicher Räume. Der Verbund verknüpfte die Universitätsinstitute für Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen und Freiburg, das Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Universität Freiburg und die kulturhistorischen Landesmuseen im Baden-Württembergs. Ein neues Promotionsvolontariat sollte wissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Zudem ermöglicht ein gemeinsam nutzbares Mobiliar Wanderaustellungen, während mit dem Format eines Pop-up-Museums begleitet und dokumentiert werden.
Neckarwestheim und Gemmrigheim
Neckarwestheim mit rund 4400 Einwohnern liegt im Landkreis Heilbronn nahe der Grenze zu Ludwigsburg. 1971 begann in einem ehemaligen Steinbruch der Bau des Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar. 1976 ging Block I, 1989 Block II ans Netz. Das Kraftwerksgelände erstreckt sich teilweise auf die Gemarkung Gemmrigheim, das zum Landkreis Ludwigsburg gehört. Die Gemeinde erhielt anfangs 50 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen, ab 1989 nur noch 30 Prozent, da sich die Betriebsfläche zu Neckarwestheim verlagerte.
Im Gegensatz zu Neckarwestheim teilt Gemmrigheim nicht seinen Namen mit der geläufigen Bezeichnung des Kernkraftwerks als „Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim“ , zudem ist auch die Sicht auf das Kraftwerk von einem Hügel oder auch im Volksmund „Atombuckel“ versperrt. Der Kühlturm wurde bewusste flach gehalten, um sich in die Landschaft des Neckartals einzupassen.
Atompolitik in Deutschland
Die Geschichte der Atomkraft in Deutschland ist von politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung geprägt. Von den Protesten der 1970er- und 1980er-Jahre über den beschlossenen Atomausstieg 2002 bis zur Laufzeitverlängerung 2010 bis hin zur Fukushima-Katastrophe 2011 und der endgültigen Abschaltung 2023 mit den letzten drei Kernkraftwerken Isar II, Emsland und Neckarwestheim II. Die Forschung in Neckarwestheim und Gemmrigheim zeigt, wie sich diese bundespolitischen Entscheidungen mikroperspektivisch vor Ort ablesen lassen. Für viele Menschen in der Region war das Verhältnis zum Nachbarn GKN komplexer als eine einfache Gegenüberstellung von Atomangst, Technikbegeisterung oder Profitgier.
Methodisches Vorgehen
Methodisch orientiert sich die Forschung am multiperspektivischen und verstehenden Zugang der qualitativen Sozialforschung in der Empirischen Kulturwissenschaft. Das Forschungsfeld wurde von unterschiedlichen Blickrichtungen, Sichtweisen und mittels unterschiedlicher Quellen und Daten untersuchen. Neben der historisch-kritischen Auswertung von Dokumenten und Archivalien wurden auch teilnehmende Beobachtungen und Interviews durchgeführt. Teilnehmende Beobachtung ermöglichte es, Interaktionen und Erlebnisse im Alltag nachzuvollziehen. Die Interviews, meist ein bis zwei Stunden lang, waren offen gestaltet, um subjektive Erinnerungen, Wertvorstellungen und Meinungen einzufangen. Von November 2022 bis Juli 2023 wurden rund 30 qualitative Interviews geführt und Archivdokumente ausgewertet. Besondere Erkenntnisse ergaben sich aus einer intensiven Forschungswoche im März 2023 in Neckarwestheim. Ergänzend wurde im Sommer 2023 eine quantitative Umfrage mit etwa 250 Teilnehmenden aus der Region durchgeführt.
Der reich bebilderte Band umfasst 356 Seiten auf welchen eine Breite an Themen von dem Lehrforschungsprojekt abgedeckt werden: die bauliche Entwicklung von Neckarwestheim, die Außen- und Innenperspektive und dessen Aushandlung während des Gemeindejubiläums „900 Jahre Neckarwestheim“, die kulturelle Dynamik zwischen Dorf und Kernkraftwerk, die Jugend in Neckarwestheim, die Wahrnehmung der älteren Bevölkerung auf die Veränderung der Gemeinden, die Rolle der Gaststätten und Besenwirtschaften, der Protest gegen Kernkraftwerk im Wandel sowie einen Beitrag zu den Arbeiter*innen des Kernkraftwerks. Neben diesen Beiträgen von Dr. Karin Bürkert und den sieben Masterstudierenden enthält das Buch einen historischen Rückblick auf Neckarwestheim von der Gemeindearchivarin Brigitte Popper, ein Interview mit Gemmrigheims Bürgermeister Jörg Frauhammer sowie Beiträge aus dem Strukturverbund „KulturWissen vernetzt“, die eine überregionale Perspektive eröffnen. Das Buch ist direkt beim EKW-Verlag erhältlich. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die einzelnen Beiträge. Zudem gibt es als Ergänzung zum Buch eine digitale Ausstellung auf Google Arts & Culture mit dem Titel „Nachbar Kernkraftwerk. Vom Dorfleben vor und nach dem Atomausstieg“.
Bürkert, Karin (Hg.): Alltag. Konflikt. Wandel. In Nachbarschaft zum Kernkraftwerk. Tübingen: EKW-Verlag 2024.