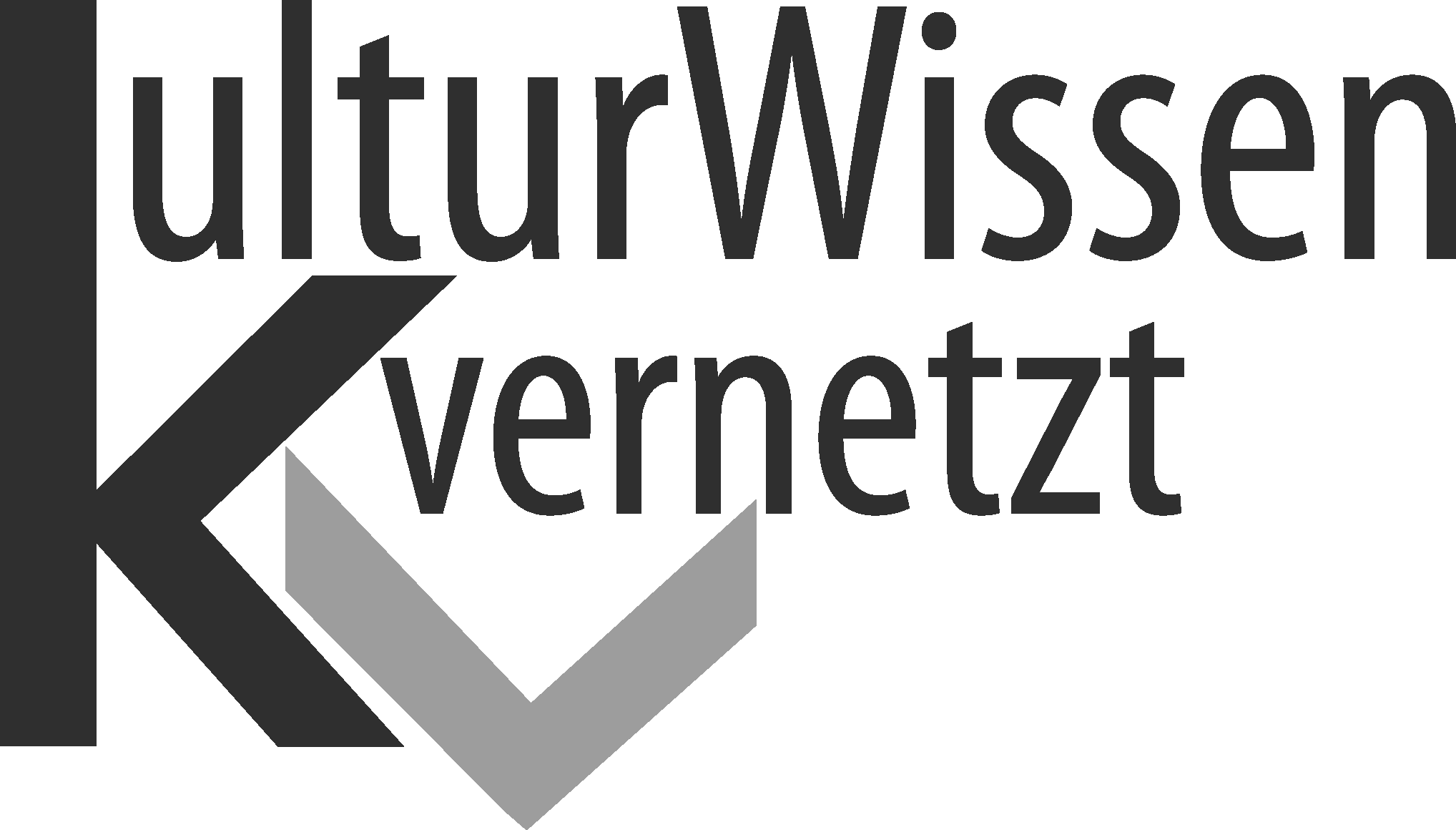Der Workshop „Gemeinsam über Stock und Stein? Wegmarken transferorientierter Kooperation“ fand am 14.12.2021 als Kooperation des Verbundes KulturWissen vernetzt und des Netzwerks transferorientierter Lehre der Universität Konstanz statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Workshop als Online-Format durchgeführt.
Der Workshop verfolgte das Ziel, die Erfahrungen von Akteur:innen in Transferprojekten zusammenzubringen und diese zu kartieren. Gerade für Transferprojekte bietet die Metapher der Wanderung eine treffende Analogie: Das Gelände ist unbekannt, das Gepäck entweder zu umfangreich oder die entscheidende Ausrüstung wurde doch vergessen. Und die Route? In klassischer Manier der Empirischen Kulturwissenschaft gleicht sie häufig eher einem (hermeneutischen) Zirkel als der Luftlinie.
Die Wanderung als Metapher für Kooperationsprozesse
Wie bei einer Wanderung durchlaufen Forschungsprojekte verschiedene Etappen, die die Beteiligten bewältigen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Die im Workshop diskutierten Etappen umfassten verschiedene Arbeitsweisen und Routinen sowie Transferkooperationen in Lehrplänen und Studienalltag, Strategien und Formate der Wissenskommunikation sowie die Adressierung unterschiedlicher Öffentlichkeiten.
Doch nicht jede Wanderung führt ans Ziel. Fehlende Ausrüstung der Wandernden, überraschende Umweltereignisse oder ein im Nichts endender Pfad können einen Abbruch notwendig machen. Auch für dieses häufig tabuisierte Ende einer Forschung wurde im Workshop Platz eingeräumt, um daraus Erfahrungswissen für neue Projekte abzuleiten.
Im Rahmen des interaktiven Workshopformats teilten sich die Teilnehmenden in Kleingruppen auf, um unterschiedliche Themenbereiche eingehend zu diskutieren. Dafür wurden die Videokommunikationssoftware Wonder.me und die Whiteboard-Anwendung Miro genutzt.
Was haben wir im Gepäck?
An einem virtuellen Tisch wurden die Erfahrungen der Teilnehmenden in das Zentrum gestellt. Als Überthema des Brainstormings diente die Frage nach unterschiedlichen Abläufen und institutionellen Logiken zwischen den kooperierenden Akteur:innen. Dabei wurden auch Missverständnisse und wechselseitige Erwartungen sowie bereits eingetretene Lerneffekte und Möglichkeiten einer gelingenden Gestaltung thematisiert.
Zur Ergebnissicherung notierten die Teilnehmenden relevante Punkte auf dem Miro-Board. Kontroversen innerhalb der Tischgruppe betrafen heterogene technische Standards und erschwerte Zugänge zu Ressourcen und Wissen über die eigene Institution hinaus. Unterschiedliche Kommunikationskanäle zwischen den Partner:innen und unterschiedliche Zeithorizonte und Planungsräume wurden als Auslöser von Problemen genannt. Die Teilnehmenden dokumentierten als Schwierigkeiten außerdem unrealistische Agenden von Förderer:innen und „Hidden Agendas“.
Als bilanzierende Statements der Tischgruppe fanden sich zwei Kommentare, die die Transparenz hinsichtlich der Agenden und die Perspektive eines gemeinsamen Ziels als Basis der Zusammenarbeit fordern. Ein anderer Kommentar merkte an, dass Chef:innen voll über den Aufwand und die Ziele informiert sein und hinter diesen stehen müssten. Vertrauensbildung und Offenheit über die Grundlagen der Zusammenarbeit wurden als wichtige Grundlagen genannt. Die Tischgruppe formulierte die Idee, die unterschiedlichen Arbeitslogiken systematisch zu erfassen, um diese transparent zu machen. Die Diversität durch die Zusammenarbeit mit heterogenen Kooperationspartner:innen wurde bildhaft als „Salz in der Suppe“ und sehr gewinnbringend beschrieben.
Engagement zwischen ECTS und Entgrenzung
Eine andere Gruppe reflektierte Erfahrungen, Herausforderungen und Erwartungen in Bezug auf studentische Mitarbeit in Kooperationsprojekten. Besonders kritisch gesehen wurde die Gefahr, Studierende vorrangig als kostengünstige Arbeitskräfte einzusetzen, ohne deren Lerninteressen oder Mitgestaltungsmöglichkeiten ausreichend zu berücksichtigen. Die Teilnehmenden diskutierten das Verhältnis von Engagement, anrechenbarer Leistung und darüberhinausgehendem Nutzen und Mehraufwand für die Studierenden.
Als Ergebnissicherung notierte die Gruppe, dass ein Strukturwandel in der Hochschullandschaft stattfinde; Hochschulen seien der Entwicklung in Bezug auf Transferprojekte aber hinterher. Eine transparentere Notengebung und eine Reflexion der Anerkennung von Leistungen wurden als dringend erforderlich angesehen. Zudem hielten die Teilnehmenden fest, dass der Wunsch nach einem schnellen Studium dem Ziel von freien Formaten zur Selbstentfaltung entgegenstehe. Kooperationsprojekte seien für Studierende manchmal anstrengend, aber auch sehr bereichernd, wenn ausreichend Zeit zur Verfügung stehe. Kollektives Lernen und Teamstrukturen wurden als mögliches Gegengewicht zur Struktur des vereinzelten Lernens genannt.