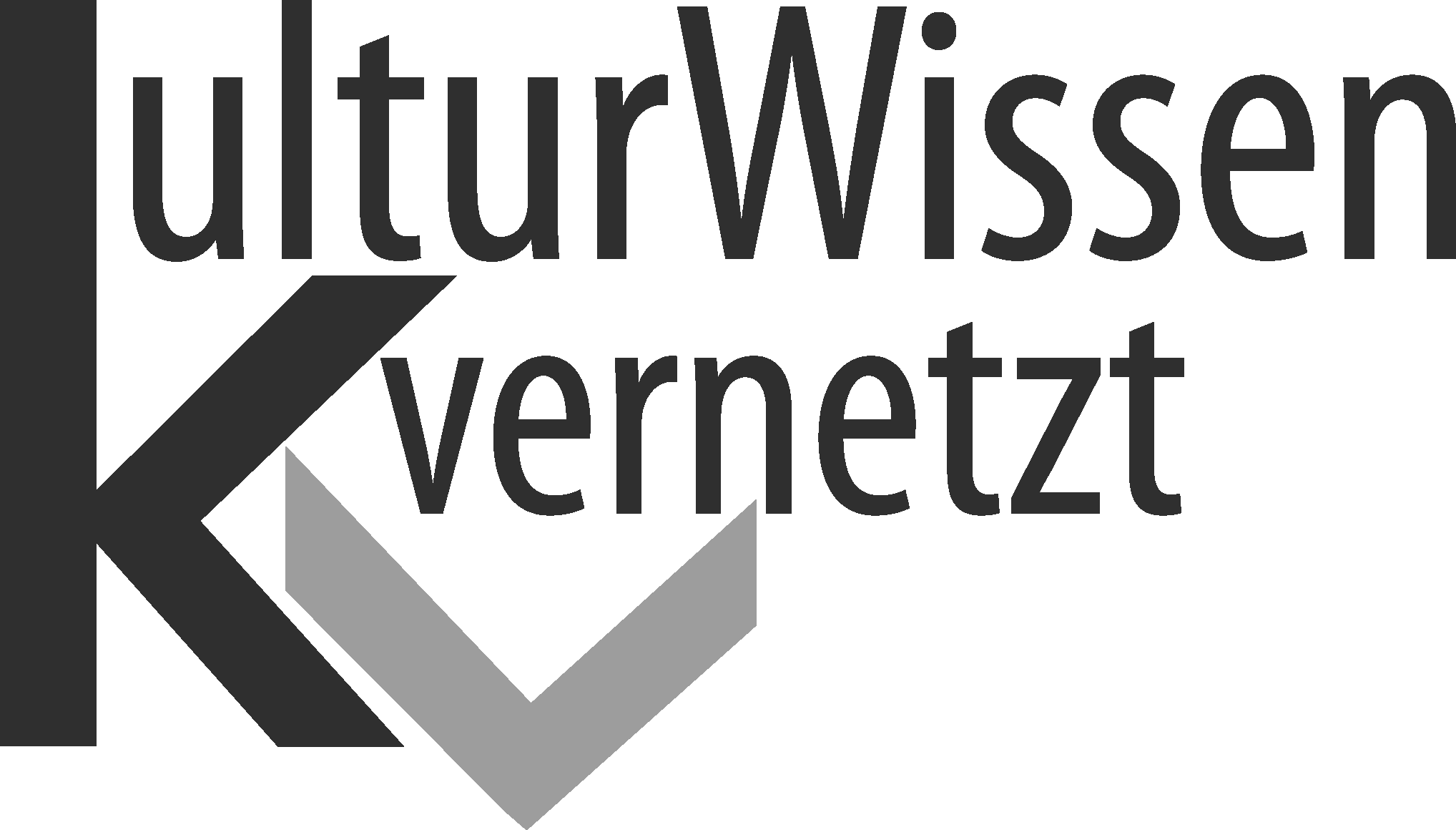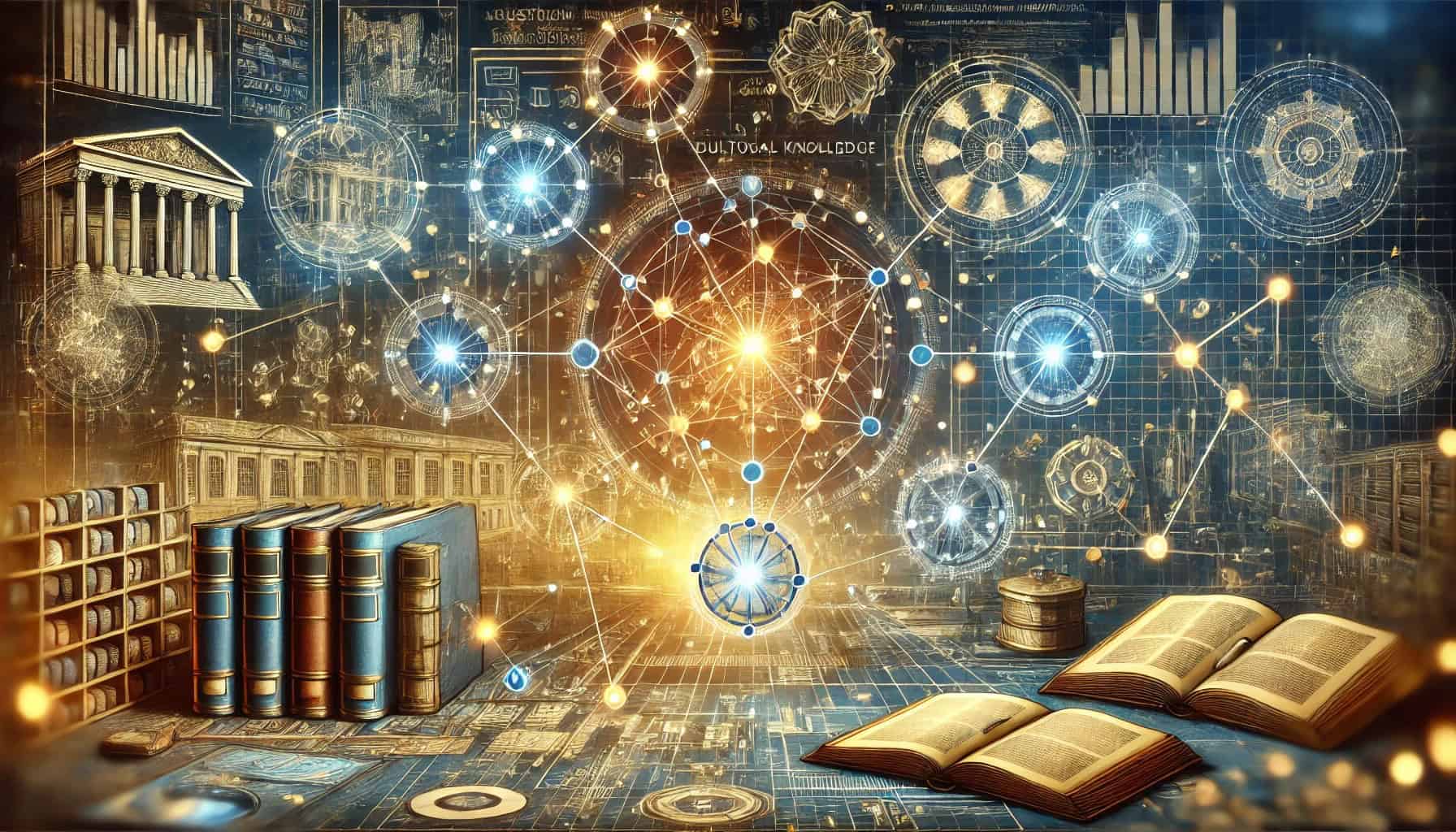Der Workshop zum Thema sammlungsübergreifender Datenbanken in Museen, Universitäten und Archiven fand vom 8. – 9.2.22 am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen statt.
Mitglieder des Strukturverbunds KulturWissen vernetzt und insbesondere Expert:innen der Datenbanksysteme verschiedener Institutionen kamen in diesem Rahmen zusammen, um Möglichkeiten der Vernetzung von Sammlungsdaten zu diskutieren. Das Thema des Workshops ergab sich aus den Ergebnissen des Vorgängerprojekts „Vernetzt lernen, forschen und vermitteln“, das die Gruppe 2019 abschloss. Die mangelnde Kompatibilität zwischen den verschiedenen Sammlungsdatenbanken war dabei als ein struktureller Stolperstein in der Zusammenarbeit von verschiedenen Sammlungsinstitutionen identifiziert worden. Verschiedene Datenbanken können auch extern aufgerufen worden, andere sind restriktiver und erlauben nur institutionsinterne Zugriffe. Ziel des Workshops war es, die ursprünglichen Gründe für die Nutzung der spezifischen Datenbanken herauszuarbeiten und technische Grundlagen und Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Datenbanken zu eruieren. Mit diesem Wissen sollten die Möglichkeiten für eine Zusammenlegung oder Verknüpfung verschiedener Sammlungsdaten eingeschätzt und projektorientierte Lösungen diskutiert werden.
Die Vorstellung der Datenbanksysteme der verschiedenen Institutionen fand am Eröffnungstag statt. Hier zeigte sich besonders, in welchem Umfang institutionenspezifische Motive und strukturelle Vorgaben die Wahl einer Datenbank beeinflussen. Kleinere und selbstständig administrierende Einrichtungen können sehr passgenau das für ihre Zwecke am besten geeignete System wählen. In größeren Organisationen existieren dagegen meist Vorgaben bzw. einheitlich verwendete Lösungen für ganz unterschiedliche Anforderungen. Im Ergebnis führt dies dazu, dass bei den Verbundpartnern für die weitgehend ähnlichen Anforderungen wie Inventarisierung, Recherche, Bestandsverwaltung und Ausspielung ganz unterschiedliche Systeme im Einsatz sind (TMS, Augias Express und IMDAS). Dies stellt eine erhebliche Hürde für den Erfahrungs- und Wissensaustausch und die vernetzte Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten dar.
Technische Einblicke
Den zweiten Workshoptag begann Christian Gries mit einer Darstellung der digitalen Strategie und des Datenmanagements am Landesmuseum Württemberg. Anschließend gab Anna Gnyp einen Einblick in Datenmanagement in Datenbanken. Themen waren hier der Dateneingang, die Strukturierung von Metadaten und die heterogenen Standards in verschiedenen Fachdisziplinen. Die Objekterfassung berücksichtigt neben Entitäten auch Ereignisse der Bearbeitungsgeschichte einer Entität.
Wie diese Daten zugänglich gemacht werden können, stellte Noreen Klingspor anschließend dar. Das LMW spielt den Datenbestand an zahlreiche Online-Sammlungen, Fach- und Kulturportale, Social-Media-Kanäle und Programmierschnittstellen aus. Sie stellte Ausspielungsergebnisse anhand des OCRE-Netzwerks des numismatischen Verbundes numismatics.org näher vor.
Über die Standardisierung von Daten und Metadaten sprach anschließend Hanna Warth. Damit Daten maschinell verarbeitet werden können, sind einheitliche Standards die Grundlage für strukturierte und vernetzte Recherchen. Im LMW werden dafür normierte Vokabulare und strukturierte Thesauri genutzt. Ziel sei es, gleiche Dinge mit dem gleichen Begriff einzupflegen. So ist eine gute Auffindbarkeit von Objekten und die Vernetzung von Beständen gewährleistet. Für die Vernetzung werden eindeutige, geteilte Felder verwendet, besonders geeignet sind gemeinsame Normdateien (GND). Hier können Verbindungen wie zum Beispiel Orts- oder Personenbeziehungen hergestellt werden.
Um die Vor- und Nachteile darzustellen, präsentierte sie Beispiele von GND-Feldern gegenüber Beispielen aus einem nicht-normierten Thesaurus. Die verschiedenen Begriffsvariationen stehen hier einer Vernetzung entgegen. Die Vorteile von strukturierten Normdaten liegen in reproduzierbaren Recherchen, eindeutiger Auffindbarkeit und Standards, die Zugänglichkeit und Vernetzung erleichtern.
Die Diskussion griff das Thema der Normdaten und die Gefahr, dass in diesen auch fehlerhafte, problematische oder verzerrende Informationen enthalten sein können, auf. Deshalb werde aktuell die numerische Form als wichtigste behandelt.
Gemeinsame Abschlussdiskussion: Austausch über vernetzte Bestände
Basierend auf den Vorstellungen der verschiedenen Datenbanksysteme und den Beiträgen zu den technischen Aspekten wurde zum Abschluss über Einordnungen und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Wesentlich war dabei der Punkt der Normdaten. Technisch werden diese als sinnvoll bewertet, inhaltlich können die Normierungen aber als konstruierte Etiketten angesehen werden, die ihrerseits zu hinterfragen sind. In Verlauf der Debatte wurde deutlich, dass die Schaffung von persistenten Standards fraglich ist.
Ein Einwand verwies darauf, dass eine Normierung zur besseren Vernetzung etwas anderes sei als eine wissenschaftliche Beschreibung. Mit der Normierung sollen Zugehörigkeiten zu Personen, Orten und Zeiträumen abgebildet werden. Es handelt sich also explizit nicht um wissenschaftliche Beschreibungen, was aber nicht von quellenkritischen Zugängen entbindet.
In weiteren Verlauf wurde der Einfluss großer Technologiekonzerne auf die Standardisierung besprochen. Google und andere Unternehmen nutzen die öffentlichen Bestände und hierarchisieren sie nach eigenen Algorithmen, die nicht nach Relevanz sondern nach Popularität gewichten. Insgesamt seien die Trefferlisten oft brauchbar, die Reihenfolge der Ergebnisse aber ein Problem.
Resümee und nächste Schritte
Thomas Thiemeyer betonte zu Beginn, dass eine Erweiterung des Open Access Begriffs geboten sei. Um die wissenschaftliche Arbeit an Museen zu berücksichtigten, müsse das Ziel von Open Access-Strategien sein, auch diese Sammlungs- und Datenbestände zu adressieren. Mit einer so ausgeweiteten Perspektive, die weit über klassische Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen im Print-Format hinausgeht, könne wichtige Überzeugungsarbeit für eine verbesserte Vernetzung auf politischer Ebene geleistet werden.
Die Vernetzung von Sammlungsbeständen sei ein zentrales Ziel der Kooperation des Strukturverbunds. Wenn es exemplarisch gelinge, die fünf Institutionen zu vernetzen, wäre ein riesiger Schritt hinsichtlich kooperativer Bearbeitung von Beständen getan, der über den Verbund hinaus von großem Interesse und Wichtigkeit ist. Ein Beispiel für die Vorteile aus der Praxis ist die häufige Doppelung von Beständen an den beteiligten Institutionen, die aber durch Fehlen von Querverweisen nicht augenscheinlich werden. Dies verdeutlicht die Potenziale von strukturiertem Wissensaustausch und vernetzter Bestände. Um dies umzusetzen, soll nicht das Rad neu erfunden werden. Lösungen sollen vielmehr auf bestehenden Voraussetzungen, Standards, Ressourcen und Expertisen beruhen. Die Vernetzung ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit und den Rückfluss von Forschungsergebnissen in die Wissenssysteme der beteiligten Institutionen. Am Beispiel des Projekts „Arbeit ist…“ auf der Plattform LEO-BW wurde gezeigt, dass einzelne Projekte bereits von der erhöhten Sichtbarkeit profitieren.
Als wichtiges Erfahrungsfeld wurden Studienprojekte genannt. Diese Projekte bieten die Möglichkeit zum Ausprobieren und Ausloten von Synergiebereichen, Praktikabilitäten und Elementen der Public Anthropology.
Als erster konkreter Schritt wurde vereinbart, dass im LMW und BLM die technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen für wechselseitige Zugriffe auf die jeweiligen Sammlungen zur Populär- und Alltagskultur geprüft werden. Dies beinhaltet neben der Gewährung von eingeschränkten Schreibrechten, die die Nutzung von Merklisten ermöglichen, auch die Beschränkung der Freigabe auf einzelne Sammlungen. Lösungen bestehender Verbundnetzwerke können hier als Blaupause dienen, interessant wäre auch ein Blick auf numismatische Sammlungen. Im zweiten Schritt sollen die exemplarisch geöffneten Sammlungen von LMW und BLM auch für die universitären Kooperationspartner geöffnet werden.
In Tübingen soll geklärt werden, welche Vernetzungsmöglichkeiten mit TMS möglich sind. Denkbar wäre eine gemeinsame, projektbezogene Nutzung der zentralen Objektdatenbank des Museums der Universität Tübingen. Hier wäre auch ein externer Fernzugriff möglich.
Für die Vernetzung der Lehrforschungsprojekte ab Oktober 2022 werden Zwischenlösungen für Datenexport und Import gesucht. Neben einer Access-Datenbank wäre hier auch die vernetzte Verwendung einer geeigneten Ausstellungssoftware eine Option.
Die Arbeitsschritte und Erfahrungen werden in den beteiligten Häusern dokumentiert. Ziel ist ein klarer Problembefund, aus dem ein Lasten- bzw. Pflichtenheft folgt. Dies soll die Grundlage für die Publikation des Ansatzes und der gemachten Erfahrungen werden.