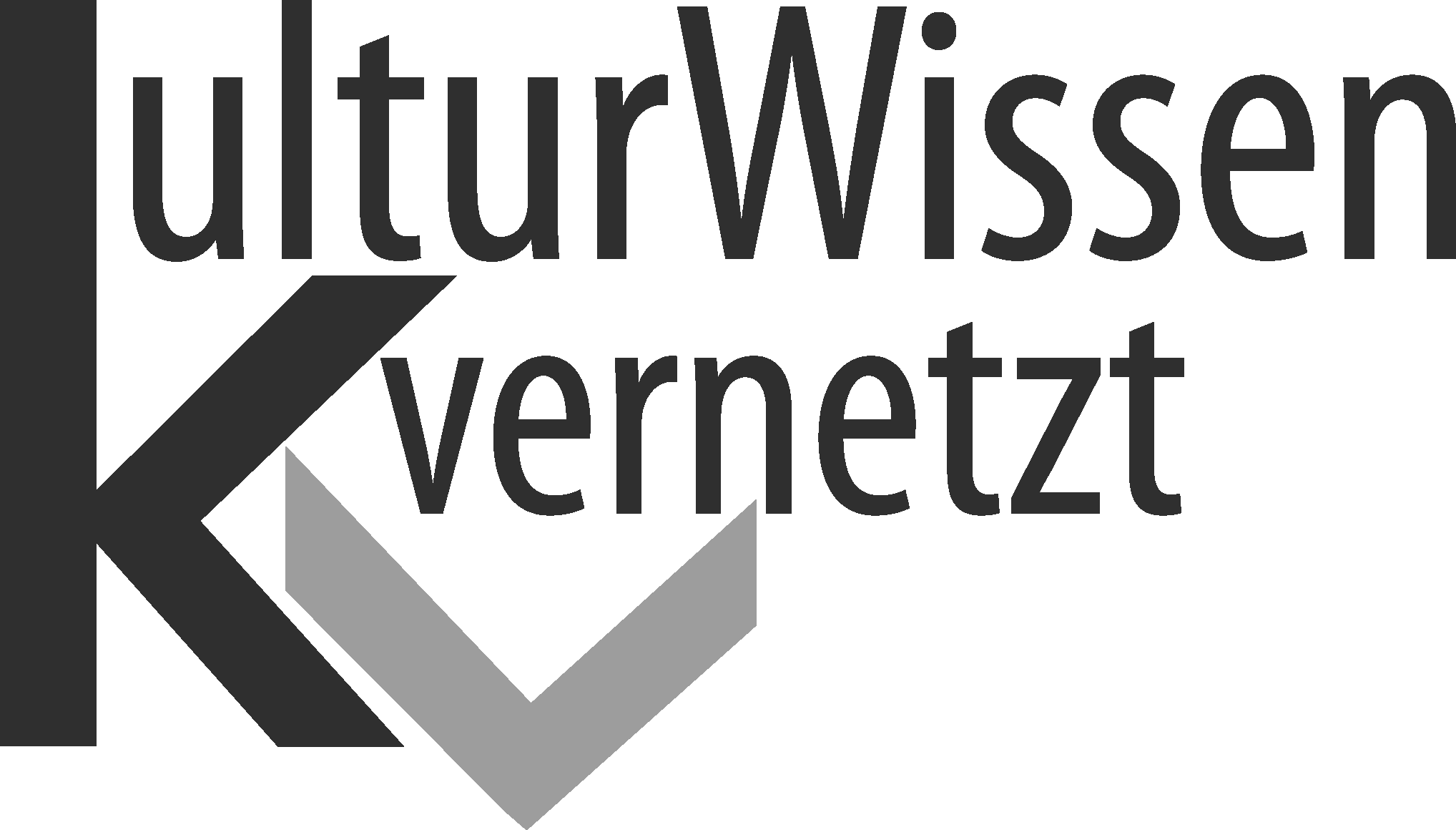Am 18. April 2024 wurde in der Reblandhalle in Neckarwestheim das Buch „Alltag. Konflikt. Wandel. In Nachbarschaft zum Kernkraftwerk“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 100 Gäste aus der Region und aus Tübingen kamen zusammen, um mehr über die Forschungsergebnisse zu erfahren. Durch den Abend führten Caroline Kunz und Johannes Alt, zwei von den sieben Studierenden, die am Lehrforschungsprojekt des Ludwig-Uhland-Institutes der Universität Tübingen mitgewirkt haben.
Grußworte
Zum Auftakt eröffnete Jochen Winkler, Bürgermeister von Neckarwestheim, den Abend mit einem Grußwort. Anschließend gab Prof. Dr. Thomas Thiemeyer vom Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft einen Einblick in das Fach, das sich mit Phänomenen der Alltagskultur in gegenwartsbezogener und historischer Perspektive befasst. Die Projektleiterin Dr. Karin Bürkert stellte den Strukturverbund „KulturWissen vernetzt“ vor und erklärte, wie die Idee des Lehrforschungsprojekts in enger Kooperation mit der Abteilung für Populär- und Alltagskultur des Landesmuseums Württemberg entstanden war.
Rückblick auf den Forschungsprozess
Caroline Kunz und Johannes Alt gaben anschließend einen Rückblick auf den Forschungsprozess, der sich über drei Semester erstreckte. Im Wintersemester 2022/2023 war das Projekt mit dem Titel „Leben in Neckarwestheim mit und ohne Kernkraftwerk“ gestartet. Eine erste Annäherung ans Feld erfolgte Ende 2022 mit einer ersten Exkursion nach Neckarwestheim, wo sich die Studierenden angeleitet durch die Neckarwestheimer Gemeindearchivarin Brigitte Popper auf die Suche nach dem „Ortsgeist“ begaben, sich also fragten, was Neckarwestheim besonders ausmacht und ob und inwiefern dieses Besondere eigentlich von dem unweit gelegenen Kernkraftwerk dominiert wurde.

Bereits im ersten Semester führten die Studierenden Feld- und Archivforschungen durch. Im März 2023 verbrachten sie einen längeren Forschungsaufenthalt in Neckarwestheim und tauschten sich bei einem gemeinsamen Wochenende im Schwarzwald mit den Verbundpartnern aus Freiburg aus, die von ihrem Projekt zur letzten Freiburger Stadterweiterung berichteten. Hier ging es darum, die Gemeinsamkeiten der sehr unterschiedlichen Aktionsräume rurbaner Transformation herauszuarbeiten und grundlegende Thesen zu den Veränderungsprozessen und zum Veränderungsdruck vor dem Hintergrund von Klimawandel und Ökonomiekrise in der Post-Wachstumsgesellschaft zu entwickeln.
Ein weiteres Highlight des Projekts rund um die Abschaltung des Atomkraftwerks in Neckarwestheim war eine Exkursion in die Schweiz zum Kernkraftwerk Gösgen, da es in Deutschland nicht mehr möglich war, ein Kernkraftwerk von innen zu besichtigen.
Zudem führte Jörg Frauhammer, Bürgermeister von Gemmrigheim, die Gruppe durch seine Gemeinde, die ebenfalls an das Geländes des Kernkraftwerkes anschließt. Die Feldforschungen konnten in einigen Fällen auf die Nachbargemeinde ausgeweitet werden. Ab Sommer 2023 begann die Phase der Transkription, Analyse und Interpretation der gesammelten Daten – ein Prozess, der schließlich in das Schreiben, Redigieren und den Buchdruck mündete.
Google Arts and Culture
Als Ergänzung zum Buch wurde eine digitale Ausstellung auf Google Arts & Culture (kurz: GAC) erstellt. Diese Plattform ermöglicht es Museen und Kulturschaffenden, ihre Werke und Geschichten weltweit zugänglich zu machen. Dank der Zusammenarbeit mit der Landesstelle für Alltagskultur war es möglich, unsere Ergebnisse in Kurzform Google Arts & Culture-Story unterlegt mit vielen Bildquellen auch einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.
Die Ausstellung, die unter dem Titel „My Neighbour – The Nuclear Power Station“ auch auf Englisch verfügbar ist, erlaubt es einem internationalen Publikum, die Forschungsergebnisse zu Neckarwestheim zu sehen.
Die digitale Ausstellung diente bei der Buchvorstellung als „Appetizer“ und sollte Lust machen, einen Einblick in das Buch zu gewinnen, das die Inhalte der GAC tiefgreifend in den insgesamt 14 Buchbeiträgen ausführt. Jede*r der Studierenden stellte im Verlauf der GAC Story ihren*seinen eigenen Beitrag vor.
Übergabe an das Landesmuseum Württemberg
Mit der Veröffentlichung des Buches ist das Thema nicht abgeschlossen, sondern wird weitergeführt. Das Landesmuseum Württemberg plant eine Pop-up-Ausstellung, die die Forschungsergebnisse in einer neuen Form zugänglich macht. Zum symbolischen Abschluss des Projekts übergaben die Studierenden den „Staffelstab“ an Markus Speidel (Museum der Alltagskultur) und Sabine Zinn-Thomas (Landesstelle für Alltagskultur). Beide präsentierten anschließend das neue Projekt KERNgeschichten.
Ausklang des Abends
Die Gäste hatten bei einem anschließenden Buffet die Gelegenheit sich auszutauschen und das Buch „Alltag. Konflikt. Wandel“ zu erwerben. Außerdem waren die Neckarwestheimer:innen eingeladen, sich Boxen für die Sammlung von Objekten für die KERNgeschichten mitzunehmen und so zum geplanten Pop-Up Museum beizutragen.